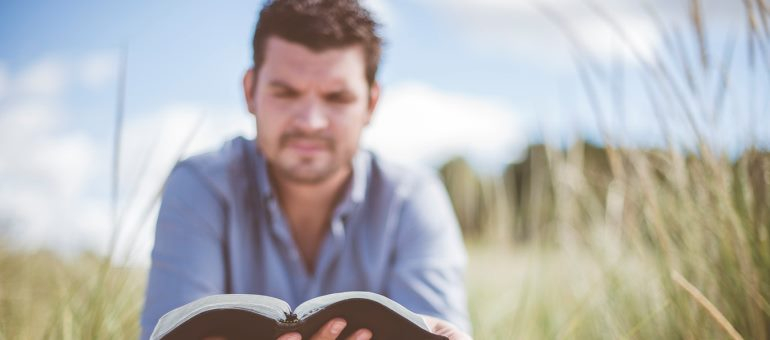Stadt & Architektur
Was im Jahre 1999 in Wien mit dem ersten Selfstorage-Lagerraum in ganz Europa begonnen hat, begeistert MyPlace-SelfStorage heute Privat- wie auch Gewerbekund*innen an mittlerweile 64 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch 25 Jahre später brauchen die Menschen Platz, um beispielsweise ihre Erinnerungsstücke, Saisonkleidung oder Erbgegenstände aufzubewahren. Und der Bedarf steigt immer weiter. Zum 25. Jubiläum des Marktführers MyPlace haben wir uns mit dem Gründer und Geschäftsführer Martin Gerhardus ausgetauscht. Dabei schauten wir gemeinsam auf die Anfänge, die das Unternehmen stark geprägt haben und sprachen auch über die Hürden und Erfolge, die MyPlace zu dem gemacht haben, was es heute ist.
MyPlace-SelfStorage arbeitet kontinuierlich daran, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu erhöhen. Die aktuellen Kennzahlen und Fakten zeigen, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist. Doch gut ist nicht gut genug – MyPlace hat sich auch für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt und plant bis 2030 den Anteil an selbsterzeugter Energie auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen. Conrad Salm und Manuel Jöchle sind bei MyPlace zuständig für die Planung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Energiebereich. Wir haben mit ihnen über den aktuellen Stand und Pläne für die Zukunft gesprochen.
Durch die Mitgliedschaft im Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (kurz VEA) ist MyPlace-SelfStorage Teil der VEA-Klimainitiative geworden. Sie unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, klimafreundlicher zu agieren, ohne dass dabei die Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt wird. Um mehr über die Hintergründe, Ziele und die Unterstützung der Klimainitiative zu erfahren, sprachen wir mit Frederik Richau, Projektleiter der VEA-Initiative "Klimafreundlicher Mittelstand".
Mit dem Bau des Standorts in Wien Aspern ist MyPlace-SelfStorage Teil einer lokalen Initiative geworden. aspern Seestadt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas und entsteht aktuell im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt. Das städtebauliche Konzept sieht vor, Wohnungs- und Gewerbenutzung entsprechend eines vom Gemeinderat beschlossenen Masterplans zu durchmischen. Dadurch wächst ein nachhaltiger Stadtteil, der hohe Lebensqualität mit dynamischer Wirtschaftskraft verbindet. Wir sprachen mit Dipl-Ing. Heinrich Kugler, ehemaliger Vorstand und jetziger Konsulent der Wien 3420 aspern Development AG, über die Initiative und den Hintergrund des großen Stadtentwicklungsprojektes.
Die Metzgerstraße im Münchner Stadtteil Haidhausen. Dort sollen künftig Menschen in einer Wohngemeinschaft zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen, die aufgrund der Entwicklungen auf dem Mietmarkt in Wohnungsnot geraten sind. Das ist das Ziel des neuartigen Münchner Wohnprojektes „Metso Metso“.
MyPlace legt großen Wert auf eine verantwortungsvolle Standortwahl. Es wird darauf geachtet, dass potenziell neue Standorte möglichst umweltverträglich platziert werden und die vorhandene Biodiversität bestmöglich unberührt bleibt. In den wenigsten Fällen werden neue MyPlace-Standorte auf neues, noch ungenutztes Bauland gebaut. Ist dies jedoch der Fall, arbeitet MyPlace mit Biodiversitätsexpert*innen, wie jene vom Gartengestaltungsunternehmen Schubert & Partner, zusammen. Was im Garten eines Gewerbegebäudes beachtet werden muss und welches Potenzial darin steckt, haben wir Eva Hauser von Schubert & Partner gefragt.
Die Mietpreise steigen kontinuierlich immer weiter in unerschwingliche Höhen. Viele können sich aufgrund dessen die Miete für eine passende Wohnung nicht mehr leisten. Ein Leuchtturmprojekt in München zeigt jetzt, dass es auch anders geht. Und zwar mit einer ökologisch vorbildlichen Anlage mit Wohnungen mit einer Miete von 9,99 Euro pro Quadratmeter.
Ein besonderes Herzensprojekt von MyPlace startete im Juni 2021 auf dem Dach des Headoffices in Wien Döbling. Im Rahmen der Bienenschutzinitiative „Projekt 2028“ von Hektar Nektar siedelte der Imker Dantcho Nikolov fünf Bienenvölker mit insgesamt 250.000 Bienen an, die fortan die Biodiversität stärken und parallel hochwertigen Honig produzieren. Dantcho und Miriam Walch, Geschäftsführerin bei Hektar Nektar, standen uns Rede und Antwort.
In vielen Großstädten Deutschlands gibt es ein großes Problem: die Wohnungsnot. Es gibt immer weniger Platz um neue Wohnungen zu bauen und der Mietpreis steigt dementsprechend weiter in unbezahlbare Höhen. Vor allem in der bayerischen Landeshauptstadt München gestaltet sich die Wohnungssuche besonders schwer. Doch wie lässt sich die Wohnungsnot bekämpfen, wenn München weder in der Fläche ausfransen, noch in die Höhe schießen soll?
Der MyPlace-Standort in Berlin-Mariendorf birgt ein Geheimnis, das Besucher*Innen verborgen bleibt. Zu finden ist es nicht etwa in einer dunklen Ecke des Untergeschosses, sondern auf dem Dach. Dort oben befindet sich unter freiem Himmel eine 600 m² große Grasfläche: Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Garten oder gar einen Fußballplatz für unsere Mitarbeiter*Innen. Das Gras erfüllt einen ganz bestimmten Zweck.
Die Suche nach den eigenen vier Wänden ist in vielen deutschen Städten nahezu ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Um mehr bewohnbaren Platz zu schaffen, kann Nachverdichtung eine gute Lösung sein: Das bedeutet, freistehenden Flächen zu nutzen sowie bereits bestehende Häuser zu erweitern. Jo Klein Architekten beschäftigen sich in Berlin mit der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der wirtschaftlich rentabel ist und sich elegant in das Stadtbild einfügt.
Fast ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs und etwa ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen sind auf den Gebäudesektor zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kam der Fünfte Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der UN (IPCC).1 Doch gleichzeitig stehen heute bereits zahlreiche erprobte und rentable Technologien zur Verfügung, die den Energieverbrauch von Gebäuden effizienter machen und CO2-Emissionen deutlich reduzieren. In vielen seiner Filialen setzt MyPlace-SelfStorage bereits auf solche Maßnahmen. In der aktuellen Expansionsphase legt das Unternehmen einen noch konsequenteren Fokus auf Technologien wie Wärmepumpen, Photovoltaik oder Retentionsdächer.
Wer viel Zeit zuhause in der WG oder dem kleinen Stadtapartment verbringt, kennt das Gefühl – die Decke fällt einem auf den Kopf und die eigenen vier Wände erscheinen auf einmal doch recht klein. Es gibt jedoch auch Menschen, die sich geleitet vom Minimalismus-Gedanken ganz bewusst für ein Leben auf sehr kleinem Raum entschieden haben. Sie haben sich dem Tiny House Movement angeschlossen. Wir haben uns die Entwicklung dieser Bewegung in der Schweiz einmal angesehen.
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr zeichnete im „Landeswettbewerb 2019 für den Wohnungsbau in Bayern“ zwölf Nachverdichtungsprojekte aus. Auffällig viele Projekte stammen dabei aus der Landeshauptstadt München. Drei davon stellen wir hier kurz vor:
Bisher waren Wohnhäuser zum Wohnen und Büros zum Arbeiten da. Eine Mischform der Nutzung könnte eine zukunftsträchtige Lösung sein für Wohnungsknappheit und Mietpreisexplosion.
Ihr wolltet schon immer einmal in einem Palast wohnen? Oder mit eurem Nachbarn jeden Abend zusammen euer hauseigenes „Hinterhof-Dinner“ kochen? Da seid ihr nicht allein. Das sind nur zwei der Ideen, die beim Social Design Award von Spiegel ONLINE, SPIEGEL Wissen und dem Fachmarkt Bauhaus eingereicht wurden.
Nicht nur Studierende lockt es nach Berlin, sondern auch viele junge Berufstätige, Pendler und Zuwanderer. Oftmals reizt sie gerade der Kontrast zwischen Tradition und Moderne: Der geschichtliche Background gegenüber dem pulsierenden Lebensstil mit Künstlern aus aller Welt und Freiraum für Kreativität, Musik und Lifestyle. Diese Elemente machen die Stadt zu einem der spannendsten Orte Europas.
Metropolen und Großstädte wachsen immer weiter und das in einer rasenden Geschwindigkeit. Für Parks, Gärten und grüne Oasen in der Betonwüste bleibt da oftmals kein Platz mehr. Wie dennoch ein Stück Natur in die Stadt kommen kann, zeigt Patrick Blanc. Der französische Biologe und Botaniker gilt als Erfinder der vertikalen Gärten.
Der Wohnraum wird knapp! Das zeigt eine Studie des Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG. Demnach lag die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Deutschland im Jahr 2016 mit 278.000 Wohnungen (inklusive Baumaßnahmen) deutlich unter dem erforderlichen Bedarf von 400.000 Wohnungen1. Kreative Köpfe aus der Baubranche müssen daher neue Innovationskonzepte liefern. Mit der Entwicklung der Floating Homes gehen sie dieser Anforderung nach. Die schwimmenden Häuser bieten einen Ausweg aus der Enge.
Sein Markenzeichen war der Löwenzahn und aus seinem kleinen blauen Bauwagen sendete er die Geheimnisse aus Natur und Technik in die deutschen Kinderzimmer. Die Rede ist von Peter Lustig aus der Kindersendung Löwenzahn. Heute würde der Held vieler Kinder sich wohl auf das Tiny House Movement berufen. Deren Anhänger schwören auf das Leben in der Enge. Aber warum? Wieso lebte jemand in einem winzigen Bauwagen und nicht in einem normalen Haus? Ein Leben auf nur 10m² Wohnfläche kann man doch gar nicht freiwillig führen. Oder vielleicht schon?
Wie lebt man eigentlich in München? Antworten auf diese Frage suchten im Juli verschiedene Künstler im Rahmen des Projekts „X Shared Spaces“ der Münchner Kammerspiele. In Zweiergruppen konnten Theaterbesucher einen Spaziergang durch München machen
Im Jahr 2050 werden laut den Vereinten Nationen zwei Drittel aller Menschen in Städten leben. Das Resultat: Megacitys – also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Heute gibt es bereits mehr als zwanzig solcher Städte weltweit, wobei die meisten davon in Entwicklungsländern liegen. Mexiko-Stadt, Lima oder São Paulo sind nur ein paar Beispiele. Vor allem Dürren und Hungerkatastrophen zwingen die Menschen in Entwicklungsländern, das Leben auf dem Land aufzugeben und in der Hoffnung auf eine höhere Lebensqualität in die Stadt zu ziehen. Auch die bessere Aussicht auf Arbeit und höhere Bildungschancen sorgen vielerorts für eine Migration in städtische Gegenden. Doch wie sieht das Leben der Menschen dort aus? Welche Entwicklungen durchleben Megastädte aufgrund der voranschreitenden Verstädterung? Und wie wird sich das urbane Leben in Zukunft verändern?
Die Ausstellung „Architecture of Storage“ im Deutschen Architektur Zentrum DAZ in Berlin zeigte die gesellschaftlichen Motive, Dinge einzulagern, zu speichern und zu sammeln sowie die „Hüllen“ des Eingelagerten, also Freeports, Datenzentren, Selfstorage-Häuser und Museumsarchive.
Einstöckige Flachbauten mit üppigen Parkplätzen sind in fast jeder Stadt zu finden. Nun geht man dazu über, auch den Platz über den Gebäuden zu nutzen.
Im Stadtbild leicht übersehbar, lagern und konservieren Storage-Gebäude unsere Dinge. Die Ausstellung „ARCHITECTURE OF STORAGE“ im Deutschen Architektur Zentrum in Berlin, die dieses Wochenende eröffnet wurde, beleuchtet die unterschiedlichen Lagerungs- und Konservierungsmöglichkeiten in der urbanen Gesellschaft.